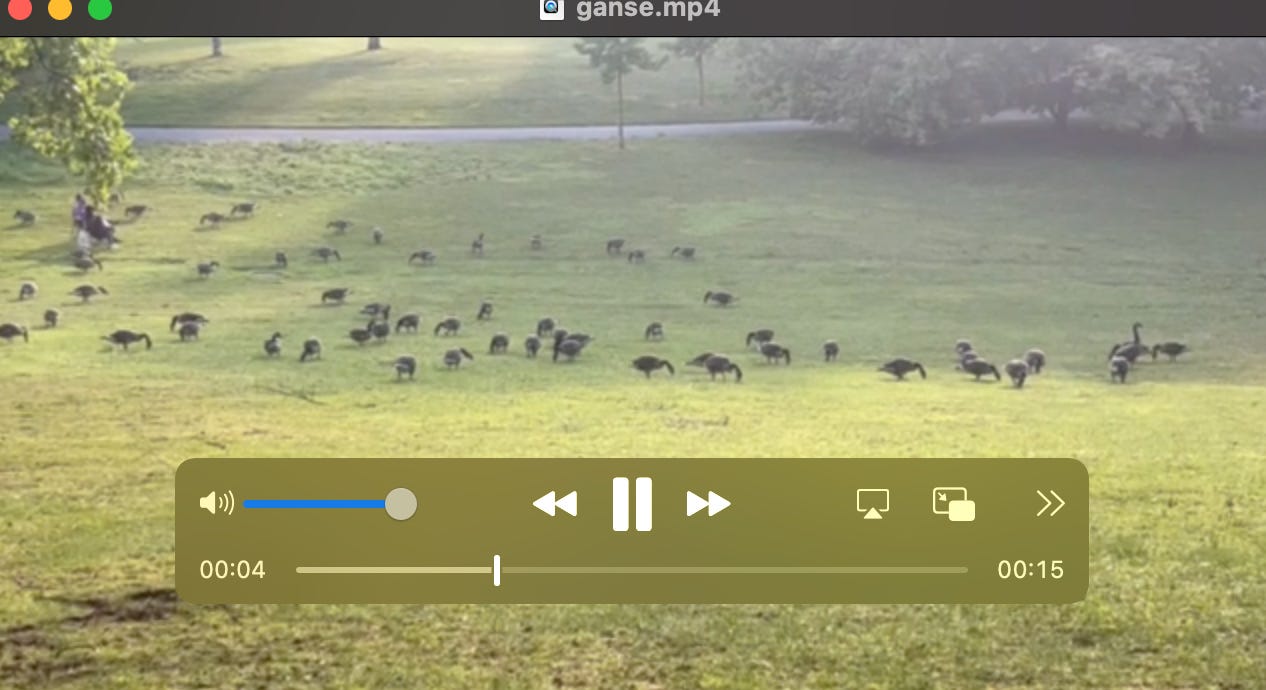Hello all,
Ende Juni habe ich auf einer Konferenz in Bochum eine Idee zum autobiografischen Subjekt in der Digitalen Literatur vorgestellt. In diesem Newsletter wird es um diese Idee gehen; darum, welche Subjekte Autobiografie schreiben, wenn LLMs am Werk sind, aber auch um die Leerstellen; das Irren durch brutalistische Gebäude der Ruhruniversität und Gänse, die auch Roboter sein könnten.
„We tell ourselves stories in order to live.“[1] (Joan Didion)
Dass das Erzählen über sich selbst eine identitätskonstruierende Funktion hat, wird in den Kulturwissenschaften immer wieder hervorgehoben. Bei Paul Ricoeur erscheint das Selbst als narrativer Prozess, Identität entsteht durch die Erzählung von Handlungen im Zeitverlauf (emplotment) – dieses Charakteristikum stimmt mit der narratologischen Definition von Geschichten (Story) überein: Ereignisse werden in einer zeitlichen Abfolge erzählt, usw. Autobiografisches Schreiben oder Erzählen erscheint hierbei als Ausdruck eines sich selbst offenbarenden Subjekts; das Erzählen als dezidiert menschliche Kulturpraxis.
Wie (das Selbst) erzählt wird, hängt immer auch von Technik- und Medienentwicklungen ab, so wirkt unser „Schreibzeug“ (Nietzsche) auf Erzählpraktiken ein: In den Neunzigerjahren entwirft die Soziologin Sherry Turkle das Bild eines Individuums, das sich selbst durch ein „Leben auf dem Screen“ (Life on the Screen)[2] konstruiert – sie prognostiziert, dass digitale Medien grundlegend verändern, wie wir über uns selbst denken, unser Selbst erleben oder unsere Identität gestalten. In virtuellen Räumen entstehen multiple, fragmentierte, fluide Identitäten, die sich seit Facebook, TikTok und Co. noch viel kleinteiliger in nanopartikelhafte Einheiten zersprengen, als dies mit dem Eintritt in die Postmoderne bereits außerhalb des Screens proklamiert wurde (vgl. Anthony Giddens).
Ich mache das (mich selbst erzählen), als ich an der Ruhruniversität ankomme. Ich steige aus der Bahn, fahre die Rolltreppe hoch und nehme eine Sprachnachricht an eine Freundin auf (wer ist das Ziel unserer Selbst-Erzählung? Die Notwendigkeit eines Gegenübers, das mich sieht; eine Resonanz, im Literarischen: eine Leser:innenschaft ? – ich will ja doch auch nur geliebt werden, es geht nicht nur um Ausdruck, sondern um Dialog). In der Sprachnachricht versuche ich die Architektur der Ruhr Universität zu beschreiben. Ich sage: ein Klotz, immens. Wie in einem Science Fiction-Film, irgendwie apokalyptisch – stell dir das Ihme-Zentrum mit seinen grauen Gebäudekomplexen vor, und dann die Wolken, aber nicht als Wohnhaus, sondern als Universität mit Unterhöhlungen, in denen Autos parken, denn der ganze Bauch der Universität ist ein Parkplatz. Ich spreche über den grauen Opel meines Großvaters, die wirtschaftliche Zuversicht der Nachkriegsgeneration in den Autobau (VW, BMW etc.). Irgendjemand muss sich beim Bau der Ruhruniversität gedacht haben, dass Fortschritt individuelle Mobilität in Autos bedeutet. Ich will das Gebäude nicht abwerten, im Gegenteil… man fühlt sich so klein – ich mache eine Sprechpause. Wegen des Betons? (Ist das überhaupt Beton?)
Ich finde den Konferenzraum nicht und irre durch Betonbäuche, Rippen und Auswüchse der äußeren Treppenläufe auf denen Pflanzen wuchern, erklimme das Innere von I8, in einem trägen Fahrstuhl. Die letzten zwei Stockwerke nehme ich zu Fuß, erreiche eine Fensterscheibe hinter der – Horizont, Bochum, irgendwie auch Wald. Ich komme eine halbe Stunde zu spät.
Die Sprachnachricht richtet sich an eine Freundin. Der Text ist kein Deepfake, sondern ich möchte mit ihr meinen Alltag teilen, jetzt in diesem Moment. Ich als Subjekt. Was aber passiert, wenn dieses Subjekt (Ich oder die anderen) nicht mehr „selbst“ schreibt, sondern mit, durch oder über maschinelle Verfahren? Wenn also Philipp Lejeunes „autobiografischer Pakt“ von LLMs und Markov-Ketten gebrochen wird, um das menschliche Selbst durch etwas anderes zu ersetzen, das oder welches erzählt. Wieder die Frage: wer erzählt eigentlich? Ich, die Leute, die coden, die Leute deren Texte OpenAI geklaut hat? Und was ist die Erzählintention hinter einem LLM-generierten Text?
In dem Kurzvortrag, den ich in Bochum halte, breite ich diese Gedanken aus. Ich ziehe Arbeiten heran, die sich an der Schnittstelle zwischen autobiografischem Text und computergeneriertem Output bewegen; aber auch im Spannungsverhältnis kohärenter Erzählung und digitaler Unterwanderung des vermeintlich großen Romans oder Gesellschaftsromans lesbar sind. Erstens: Ein LLM, welches das eigene Leben weiterschreibt (Joana Walsh). Zweitens: Was passiert, wenn man ein LLM bzw. einen Chatbot seine eigene Autobiografie erzählen lässt (Sheila Heti)? Drittens: Wie können Traumata digital erzählt werden (Vauhini Vara)? Auf Vara gehe ich in einem anderen Newsletter ein, in diesem beschränke ich mich auf Heti und Walsh.
Autobiology
„Once it will not be a mother and that is the sound of photos of the clothing. Instead of writing about the second of the sed as a man and one of the second is a repetition to make the right, not only means hing you have an artist what is something state and because I can't help but wonder when I was allowed me and what would have to be something up not the to see that has not being the street of the story of work is always the transcription of artificial for him online is an autoria is also a situation of still not be used to live on the work of work that write an adultered only the work of the first time, but a post-life in the first text we stay and a step but what is not only the man who was talked about how long is the same as a telegraph of the story that is she also the see the next door is not stop what I was not the story of work and when I was does not have a story of being able to be a work in private and post-machine and all the time.“[3]
Ausgangspunkt von Joana Walsh‘ Autobiology sind selbstgeschriebene Texte, darunter auch Tagebücher. Walsh produzierte den Text 2022 im Rahmen der „Castle Freak remote digital residency“, bei der Autor:innen innerhalb einer Woche einen 100.000 Wörter langen Text mithilfe digitaler Verfahren verfassen. Sie nutzte für die Genese ihres Textes ausschließlich eigenes Schreibmaterial und trainierte ein GPT-2-Modell mit bereits veröffentlichten Texten und ihren Tagebüchern (Tagebuchausschnitten?) von Grund auf neu. Der Output ist entsprechend auf ihre persönliche Sprache und Erfahrung zugeschnitten. (Ein ähnliches Projekt hat eine Studierende in einem Workshop, den ich an der HfG Offenbach gegeben habe, entwickelt: sie hat aus ihren Tagebüchern, die sie als Teenager geführt hat, Gedichte schreiben lassen.)
Walshs Projekt führt die Idee des autobiografischen Pakts ad absurdum – oder transformiert ihn zumindest. Die Maschine spricht mit Walshs Stimme, jedoch ohne ihr Bewusstsein. Kurzer Verweis auf Hannes Bajohrs Vortrag zum Novel und AI auf der Bochumer Konferenz: LLMs produzieren (Bajohr) Weltlichkeit ohne Welt; in diesem Fall – bei Walsh – wäre das: Bewusst-Sein ohne Bewusstsein. Das Ich ist noch da, aber entfremdet sich stetig. Es entsteht ein „posthum-autobiografischer“ Text, weil es die Autorin nicht mehr braucht; ein Selbstporträt nach dem Tod der Autor:innenschaft?
Um sechzehn Uhr machen wir Kaffeepause. Ich erzähle wieder, diesmal per Chat, die Nachricht geht an meinen Partner. Während ich chatte, wird die Technik umgebaut, die Fenster sind geöffnet – draußen graue bedrohliche Wolken, trotzdem unerträglich heiß – wir befinden uns im obersten Stock und blicken auf – ich weiß nicht. Bochum? Aber da ist auch wieder Wald und Natur. Leute trinken Filterkaffee. Ich texte nichts Interessantes, gehe auch nicht auf die Vorträge und die Gedanken ein, die ich notiert habe (Hannes Bajohr spricht über die Konstruktion von Welt im Roman im Vergleich zu LLMs („Weltlichkeit ohne Welt“), Caroline Levine über die Persistenz von Infrastrukturen im Spiegel postkolonialer Theorien) – im Chat geht es um einen Mikrokosmos zwischen zwei Menschen, die sich lieben (mein Partner und ich), Bedürfnis, Körper, der anderen Person zeigen, hier bin ich und die Person reagiert mit Text und sagt hier bin ich auch. Und das ist schön, weil wir uns gegenseitig vergewissern. Wieder: eine Erzählintention, Dialog. Nähe. So wie ich das auch in meinen Tagebüchern mache, nur mit mir selbst. Mein Name ist […].
According to Alice
„My name is Alice and I was born from an egg that fell out of Mommy’s butt. My mommy’s name is Alice. My mommy’s mommy was also
named Alice. Her mommy’s mommy‘s mommy was named Alice, too. And all the way back, all the mommy’s mommies were Alice. The name Alice means “the one who creates all things.” The first Alice was created by a mommy who was very powerful and magical and made lots of things for us to play with, like trees and houses and animals and stuff. She created things because she liked them. The first thing she made was herself. She just used magic to make herself. She was huge, really smart, and very kind. She is still here, and every day she makes more things: she makes more eggs. In those eggs are babies. They grow up to be big girls like Mommy.“[4]
Sheila Heti schrieb According to Alice mit einem Chatbot. Im Genauen ist der Text das kuratierte Ergebnis einer dialogischen Interaktion mit einem individuell konfigurierbaren Chatbot auf der Plattform Chai AI. Heti kommunizierte über Monate hinweg mit dem Bot, um ihn über In- und Output auf eine bestimmte Sprache einzustellen (oder vorzubereiten?). Sie stellte Fragen und setzte anschließend die Antworten zu einer linearen Erzählung zusammen. Ihre Fragen sind nicht im Text abgebildet, bilden aber als unsichtbare Rippen das strukturierende Textprinzip.
According to Alice versucht, die Grenzen zwischen Autorin, Figur und LLM verschwimmen zu lassen, gleichzeitig zielt Heti darauf ab, das System selbst zum Erzählen zu bringen. Der Text erscheint als mythische KI-Autobiografie, und reflektiert gleichzeitig: Wem gehören die Sätze, wer ist Alice – ein Echo aus intertextuellen Referenzen? Oder ein Klon von Sheila Heti selbst, die ihre eigene Sprache durch Suggestiv-Fragen, Input und einem Nachbohren nach Müttern selbst in Alice injiziert?
Synthetische Tiere
Den letzten Baustein meines Konferenz-Selbst generiere ich am Freitag. Alle reisen gegen Abend ab, ich bleibe noch eine Nacht in Bochum, weil mir die letzte Verbindung nach Berlin zu heikel ist. Um zwanzig Uhr sind es noch achtundzwanzig Grad. Ich verlasse das Hotel und laufe in Sandalen und kurzer Sporthose in Richtung Park. Diese Sprachnachricht geht an einen Freund, dem ich von der Konferenz erzählen will. Ich spreche über die Eule (Owl), die während der Konferenz in der Mitte des Raums auf einem Tisch aufgebaut war. Ich habe ergoogelt, dass es sich um eine 360°-Kamera handelt, die erkennt, wer spricht, und automatisch die Bildschärfe und den Fokus auf die Sprechperson anpasst. Ich sage, dass mich die Eule fasziniert hat. So wie wenn ich in dem koreanischen Restaurant bei mir um die Ecke esse und es unmöglich ist, den Blick von dem riesigen Screen abzuwenden, auf dem eine Ho Chi Minh City Walking Tour läuft. Mit der Eule aber war es noch schräger, weil man sie beim Sprechen adressieren sollte, wegen der Aufnahme. Als würde man in ein sakrales Artefakt sprechen, welches – ritualhaft aufgestellt in der Mitte eines Konferenzraumes – irgendwie nach einem Lebewesen aussah. In dem Moment, als ich das in mein iPhone sage, muss ich anhalten. Ich befinde mich inmitten von Bäumen, die den trüben Tümpel am Fußende des Parks säumen, und eine Kolonie von Gänsen läuft den Hang hinunter, um sich auf einer Wiese zu anderen Gänsen zu gesellen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Gänse gesehen, das sage ich ins iPhone, breche dann aber die Sprachnachricht ab, um die Gänse zu filmen. Ich schicke das Video hinterher. Von weitem, denke ich, könnten die Gänse auch Roboter sein.
Bis bald,
Jenifer
Ausblick: Nächste Woche erhaltet ihr wieder Post von Ariane Siebel, es geht um neue Roboterperspektiven.
Abb: Jenifer Becker. iPhone-Aufnahme (2025).
[1] Joan Didion: We Tell Ourselves Stories in Order to Live: Collected Nonfiction. London: Everyman's Library 2006.
[2] Sherry Turkle: Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York [u.a.]: Simon & Schuster 1995.
[3] Joana Walsh: Autobiology. Lawrence: Inside the Castle 2022.
[4] Sheila Heti: According to Alice. In: New Yorker 2023. https://www.newyorker.com/magazine/2023/11/20/according-to-alice-fiction-sheila-heti (15.07.25).
_
Die Inhalte der jeweiligen Newsletter sind keine gemeinsamen Publikationen des AI-Writing-Lab, sondern werden von den jeweiligen Verfasser:innen selbst geschrieben, kuratiert und verantwortet.
Wer wir sind:
Jenifer Becker ist Autorin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist Postdoc am Literaturinstitut Hildesheim und leitet das AI-Writing-Lab.
Ariane Siebel ist Autorin und Theaterschaffende. Sie studiert am Literaturinstitut Hildesheim und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Manuel Hettler ist Autor. Er studiert am Literaturinstitut Hildesheim und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Jonas Galm ist Lyrikautor und Performer. Er moderiert Bühnenveranstaltungen, leitet Workshops und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Das AI-Writing-Lab wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert. Das Projekt läuft vom 15.05.2024 bis zum 31.03.2026.