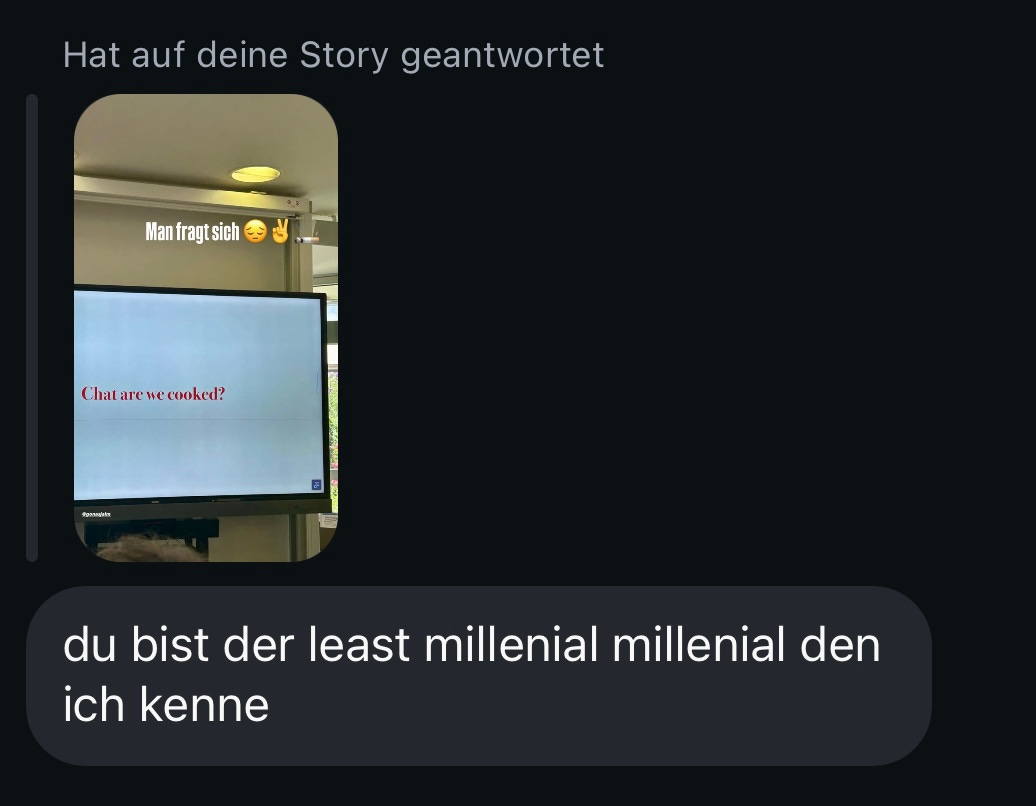Künstliche Fossilien: Das Walross und die Immersion oder Auf die Kuration kommt es an
Jonas Galm
Ich hatte einen Machbarkeits-Moment mit KI. Meine politische Skepsis gegenüber einem ziemlich durchschaubaren Geschäftsmodell hat geschwiegen. Meine ästhetischen Störsignale haben geschwiegen. Mein kulturpessimistischer Sisyphus-Patronus, der die sukzessive Verwelkung unserer Sprachfähigkeit befürchtet, hat am lautesten geschwiegen. Schuld an allem waren ein Walross, ein Netzhemd und eine Angel.
Vorvergangenen Freitag, am 4. Juli, fand unsere Performance-Lesung “AUSLÖFFELN!” am Hauptcampus der Uni Hildesheim statt. Ariane Siebel, Emilia Jewgenija Klein, Malte Abraham, Wilma Schapp, Laura Froböse, Manuel Hettler und ich haben unsere KI-Projekte auf die Bühne gebracht, Ariane und ich haben moderiert. Streckenweise haben wir unsere Texte vollständig improvisiert, grotesk und irgendwie unverbraucht war das alles. Ein Happy Place: nichts musste weiterverwertbar oder perfekt sein. Dadurch war es reich. Kann sein, dass man sich mit KI gerade Sachen traut, die in ein paar Jahren schon nicht mehr möglich sind: zu trashig, zu Midtwenties, zu Millenial. Kann sein, dass Videos, die uns jetzt contemporary-clever und irgendwie meta vorkommen, bald so richtig ur-stein-alte Relikte sind.
Immerhin: ein Gegen-Indiz zur vorangegangenen Befürchtung, einfach altbacken zu sein.
Noch ist KI Neuland, und mein Pro-Contra-Pendel schlägt ziemlich beständig in beide Richtungen aus. Ich möchte mir von einer KI – also errechneten Durchschnittswerten und stochastischen Schlachtplänen – keine Ästhetik vorschreiben lassen, ich finde den sich abzeichnenden fortschreitenden Realitäts- und Kontextverlust gefährlich.
ABER – solange die KI Fehler macht, hat sie grundsätzlich so viel künstlerisches Potential wie jedes Archiv, jedes Antiquariat, jeder Writers‘ room auch. Solang ich nicht weiß, wohin mein Wunsch führen wird (solang ich also halbwegs dilettantisch und ineffizient prompte), habe ich Hoffnung. Nicht in die KI als selbstständige Produzentin, sondern in uns Kunstschaffende als Kurator:innen.
Das wäre eine Verschiebung, die ich problemlos hinnehmen könnte: wenn Kunst seltener Handwerk plus Kreativität plus Zeit, dafür öfter Konzept plus Kuration plus Zeit bedeuten würde (das Handwerk als eigene Kategorie könnte an Sichtbarkeit sogar dazugewinnen). Der Faktor (Kunst braucht) Zeit ist dann immer noch da und muss anderswo – realpolitisch – gelöst werden. Aber im kreativen Schaffensprozess selbst kann KI tatsächlich eine Art Befreiung bedeuten, besonders, wenn sie glitches produziert.
Die Verantwortung liegt dann bei uns: macht dieser glitch etwas, das neu oder interessant ist? Berührt er mich? Sagt er mir etwas oder, noch besser, lässt mich etwas sagen?
Das Projekt, das ich für die Performance vorbereitet hatte, war eine Art Collage aus Bildern, Songs und Gedichten, die die Sehnsucht und Liebe meiner Bühnenfigur zu einem Walross namens Arnold Rügen einfangen sollten.
Auf einer Leinwand wurden Bilder projiziert, für die meine Photoshop-Skills niemals ausgereicht hätten. Dazu liefen Songs verschiedenster Genres (Indie, Folk, Oper, Punk), die ich unmöglich hätte selbst schreiben oder produzieren können. Teilweise waren die Texte, die ich zusätzlich gelesen habe (Liebesgedichte und träumerisch-diffuse Erinnerungswolken) KI-generiert und von mir modifiziert oder neu zusammengesetzt. Udio, ChatGPT und midjourney sind die (austauschbaren) Programme, die ich in diesem Fall verwendet habe.
Aus einem kurzen, harmlosen Gedicht, das mit eleuther (ein Ableger einer früheren, leistungsschwächeren Variante von ChatGPT) entstanden ist, war in ein paar digitalen Nächten eine kleine Love-Lore entstanden: all eyes on Arnold, das Walross, das mir (im Setting der Performance: ein gelangweilter Angler im grünen Netzhemd) einmal vor Rügen erschienen und bald darauf alles war, was für mich überhaupt noch zählte. Außer dem Walross gab es, so unsere Diegese, kaum noch Lebewesen auf der Erde seit der biblischen Katastrophe: eine sintflutartige Menge von Suppe war über die Welt gekommen. Die Ebene “absurder Bühnenquatsch”, die ich zuvor mit Fischmaske und pantomimischen Einlagen bespielt hatte und nicht missen möchte, verschob sich hin zu einer erstaunlich authentischen Ergriffenheit: ich fing an, Arnold und meine Sehnsucht nach ihm ernst zu nehmen und körperlich zu spüren. Mehr kann ich vom Format „Bühne“ nicht wollen.
Auch beim Verfolgen der anderen Beiträge, beim gemeinsamen (ergebnisoffenen) Moderieren, bei einem dezidiert improvisierten Bühnenspiel mit Malte Abraham, das prompts wie Chatbots analog persiflierte, beschlich mich ein Gefühl von Assoziation, von Stimmigkeit, das für mich zu den höchsten Bühnen-Gefühlen und klarsten Gründen fürs Kunst- und Kultur-Schaffen zählt. Vielleicht war das auch ein weiterer Beweis dafür, was Immersion mit uns anstellen kann, wenn man sie lässt.
Dass auf der Bühne zu stehen und eigene Projekte zu inszenieren sich gut anfühlt, ist keine Neuigkeit. Produktiv für mein Nachdenken über KI wird der Abend durch folgende Erkenntnisse:
Glitches sind mit KI weiterhin möglich (und machen Spaß) – einem Musikprogramm, das nach Tempo, Genre etc. fragt, stattdessen ein Gedicht vorzulegen, provoziert Halluzinationen, die über das zuvor Gewollte hinausweisen können.
Präzises Prompting kann trotzdem auch Teil kreativer Arbeit sein und wird als neue Form der Medienkompetenz wahrscheinlich sogar dringend notwendig.
Der fun, den man so erzeugen kann, ist zwar in seiner Aussagekraft per se beschränkt, aber er unterscheidet sich in dieser Beschränktheit kaum von bisherigen Formen des fun: Quatsch kann
einfach Quatsch bleiben oder braucht
bewusste Kuration, um (zum Beispiel subversiv) zu wirken.
Kunst lässt sich nicht totkriegen und wird auch im KI-Zeitalter subversive Gänge bauen, die niemandem und allen gehören.
Claudia Hamm hat in unserem KI, was tun?-Gespräch im Januar darüber nachgedacht, ob es bloß eine stärkere Produktions- statt einer reinen Rezeptionsästhetik bräuchte, um unsere KI-Faszination (Walter Benjamin würde sagen: den Choc) ein wenig zu erden: uns würde dann vielleicht bewusst, dass nichts selbstverständlich ist, nichts wie von selbst und einfach so da ist, schon gar nicht Kunst – es wäre der Blick in die Blackbox.
Eine intakte Produktionsästhetik fragt nach den Herstellungsbedingungen eines Kunstwerks, statt das Ergebnis zu isolieren, sie spürt Prozessen nach: wie ist das entstanden, welche Irrwege waren dafür nötig, welches Material habe ich verwendet? In welchen Zuständen (und mit welchen prompts) habe ich daran gearbeitet? Ein Gegenbild: wir sehen KI-generierte Bilder und sagen: wow, toll, wie echt das aussieht! wie authentisch nach Ghibli, wie schön grotesk! Ich wünsche uns, dass wir aus diesem oberflächlichen Staunen eine Wahrnehmungsform und künstlerische Praxis destillieren, die unsere genuinen Bedürfnisse nach Wiedererkennen, Erkenntnis, Weltflucht, Überraschung und Sinnerzeugung anspricht, übersetzt, vielleicht sogar erfüllt, ohne uns zu sedieren.
Einen letzten Gedanken will ich hier nur anschneiden und nächsten Monat an dieser Stelle weiter ausführen. Er stammt aus einem Essay, den ich für eine Konferenz zum Thema KI erarbeitet habe, in deren Rahmen auch die Performance stattfand.
Ein schöner Nebeneffekt von KI-Kunst, wie ich sie hier meine (fehleranfällig, irritierend), könnte nämlich sein, dass wir ästhetischen Befindlichkeiten mehr Platz im politischen Diskurs einräumen, wie es vielleicht der Surrealismus und der Dadaismus vor hundert Jahren versucht haben. Im Fall von Surrealismus und Dadaismus kann man heute leicht die konstitutive politische Komponente vergessen, vom historischen Kontext lassen sich aber beide nicht loslösen. Rationalisierung und wissenschaftlicher Primus waren auch da auf dem Vormarsch, es waren die Geburtsjahre der Soziologie und der Psychoanalyse, des Analytic Turn und des Positivismus. Der Mensch war längst ein rationalisiertes Wesen. Offenkundige Parallelen zum gegenwärtigen Jahrzehnt sind Teil der Lebensrealität aller, die Tagespolitik verfolgen oder Teil der popkulturellen Verarbeitungskollektive sind: Krieg, Inflation, Faschismus, Pop, ein Papst stirbt, weißer Rauch steigt auf, die Geschichte schreitet voran. Der moderne Mensch weiß sich nicht mehr zu helfen. Große Visionäre treten auf den Plan und erzählen große Geschichten. Erklären die Welt. Massen setzen sich in Bewegung. Was macht die Kunst? Die Frage, wie ästhetischer Widerstand sich in einer spätkapitalistischen Welt sinnvoll konstituieren kann, beschäftigt mich seit Längerem und immer aufs Neue.
Wie Macht und Ästhetik zusammenhängen und einander bedingen, ist sicher ein Fass ohne Boden. Ich will trotzdem gern einsteigen und schauen, wohin es mich treibt, was ich finde und ob ich am Ende einen großen Wasserfall hinabstürzen werde.
Bis demnächst! Jonas
Mein Fund der Woche: der Hanser akzente-Band AUTOMATENSPRACHE, den die Übersetzerin, Essayistin und Regisseurin Claudia Hamm im Juni 2024 herausgegeben und kuratiert hat, versammelt verschiedene KI-kritische Stimmen informativ, kompetent und unterhaltsam.
AI-Writing-Lab
Die Inhalte der jeweiligen Newsletter sind keine gemeinsamen Publikationen des AI-Writing-Lab, sondern werden von den jeweiligen Verfasser:innen selbst geschrieben, kuratiert und verantwortet.
Wer wir sind:
Jenifer Becker ist Autorin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist Postdoc am Literaturinstitut Hildesheim und leitet das AI-Writing-Lab.
Ariane Siebel ist Autorin und Theaterschaffende. Sie studiert am Literaturinstitut Hildesheim und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Manuel Hettler ist Autor. Er studiert am Literaturinstitut Hildesheim und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Jonas Galm ist Lyrikautor und Performer. Er moderiert Bühnenveranstaltungen, leitet Workshops und ist studentische Hilfskraft im AI-Writing-Lab.
Das AI-Writing-Lab wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert. Das Projekt läuft vom 15.05.2024 bis zum 31.03.2026.